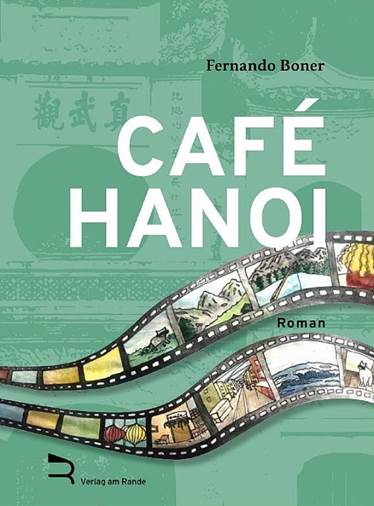Fernando Boner‘s
Erstlingswerk
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
Was steckt drin? / Pressestimmen
|
Leseprobe:
Prolog
Tief in den Alpen gibt es eine Höhle, die einst von einem sagenumwobenen Bären bewohnt war. Die Einwohner des umliegenden Tals fürchteten sich vor ihm. Man erzählte sich die schauerlichsten Geschichten. Tatsächlich war er nicht böse. Das Tier war weise und hatte einen ungewöhnlichen Charakter. Aber durch seinen eigenen Willen und seinen Erlebnishunger war es für die Menschen unberechenbar. Fast jeden Tag unterhielten sich die Leute im Dorf über den pelzigen Genossen, der oftmals zufällig ihre Wege kreuzte und ihnen durch seine bloße Präsenz Todesangst einjagte. Dann wurde das Tier erlegt. Im Tal aber fehlte nun seine Seele, seine eigenwillige Art. Fortan suchten die Menschen im eigenen Dorf Sündenböcke und Projektionsflächen für ihren mangelnden Mut ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Sie zerstritten sich. Mit der Zeit bildeten sich dicke Ranken um die Bärenhöhle, die von schwarzen Raubvögeln und üppigen Bergblumen bewacht wurde. Dann entdeckte ein Mädchen den verlassenen Unterschlupf, der eine atemberaubende Aussicht auf das Tal und die umliegenden Bergseen gewährte. Der Ort wirkte wie der verlassene Turm einer zerfallenen Burg. Die Kleine begann in der Abgeschiedenheit mit dem verstorbenen Tier zu sprechen und man sagt, das Kind entwickelte ungewöhnliche Kräfte. Das Mädchen hieß Amy.
|
|
Amy und das »Nichts«
Tränen auf meinen Wangen. Ich wachte schluchzend in meinem Bett auf, riss mich aus meinen Laken. In meinen Gehirnzellen das Nichts. Tatsächlich war mein Leben ein unerklärbares kleines Desaster – aber das wollte ich mir damals um keinen Preis eingestehen.
Salenz, mitten in den Alpen. Mein Kopf war voller Pläne und Lebensentwürfe und ich verbrachte ganze Wochenenden mit Lesen. Jane Austen, Platon und psychologische Selbstfindungsliteratur. Ich fühlte nicht die Kraft in mir, mich zu finden, und war von der Angst besessen, die falschen Entscheidungen zu treffen – tatsächlich wusste ich: Ich würde nichts ändern in meinem Leben. So wählte ich die Entscheidung, keine Entscheidungen zu fällen. Status quo.
Seit jeher war ich Single und fand an dieser Tatsache nichts Ungewöhnliches. Am Feierabend wartete ein hübsches 2-Zimmer Appartement mit Bodenheizung und eigener Waschmaschine auf mich, das mir einen beneidenswerten Blick auf das glitzernde Alpenpanorama gönnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, mich jemals vom Blau der Berge zu trennen. Hier waren Mama und Papa groß geworden. Hier war meine Heimat, hier fühlte ich mich als ich selbst. Andere Orte faszinierten mich durchaus. Ich hegte eine Schwäche für das geschäftige Zürich und das poetische Paris. Wie liebte ich es, mit meiner Schwester Cindy an der Limmat abzuhängen. Wir aßen Thunfischsandwich und tranken Coco Cherry, während der Fluss tiefblau atmete und wir über die vorbeischlendernden Menschen lästerten. Mich faszinierte der zur Schau gestellte Snobismus. Sündhaft teure Sommerröckchen, an dunklen Sonnenbrillen hängend, flatterten in der Seebrise – anonyme Großstadtkühle.
Aber ich liebte das Parfum der Alpen. Die beschauliche Übersichtlichkeit verlieh mir Sicherheit und Orientierung in einem Leben, das, wie ich mit zunehmender Distanz von meiner Mädchen- und Teenagerzeit spürte, mit immer drängenderen Fragen auf mich losdonnerte. Ich kleidete mich dezent stylisch und mein sorgfältig ausgesuchtes Outfit verlieh mir einen klassischen Touch. Mein Haar war dunkelblond gelockt. Zu speziellen Anlässen steckte ich es zu einem Turm auf, der, wie man mir sagte, mich selbstbewusst und verheißungsvoll erscheinen ließ. Ich hielt einen Waschbären, genannt Bob – ein Mitbringsel meiner Tante von einer Überseereise. Davon abgesehen pflegte ich keine nennenswerten Interessen. Spaziergänge in der Dunkelheit bestärkten mich in meinem Gemüt. Alles in allem verlief mein Leben wie eine Reise mit den Schweizerischen Bundesbahnen. Im Takt und mit perfekter Vorausschaubarkeit – aber laaaaaangweilig. Nichts, das meine Emotionen ins Vibrieren versetzte, nichts, das meinen Geist in eine Verrücktheit brachte. Ich lebte, so wie ich gelernt hatte, eine Existenz zu führen: berechnender Gefühlshaushalt und beklemmende Angepasstheit. Wie ein ferngesteuerter Buchhaltungsroboter. Und als wäre ich klinisch tot, stolperte ich durch meine Existenz – ein Dasein ohne Aussicht auf Glück und Befreiung: War das überhaupt ein Leben? . . .
|
|